






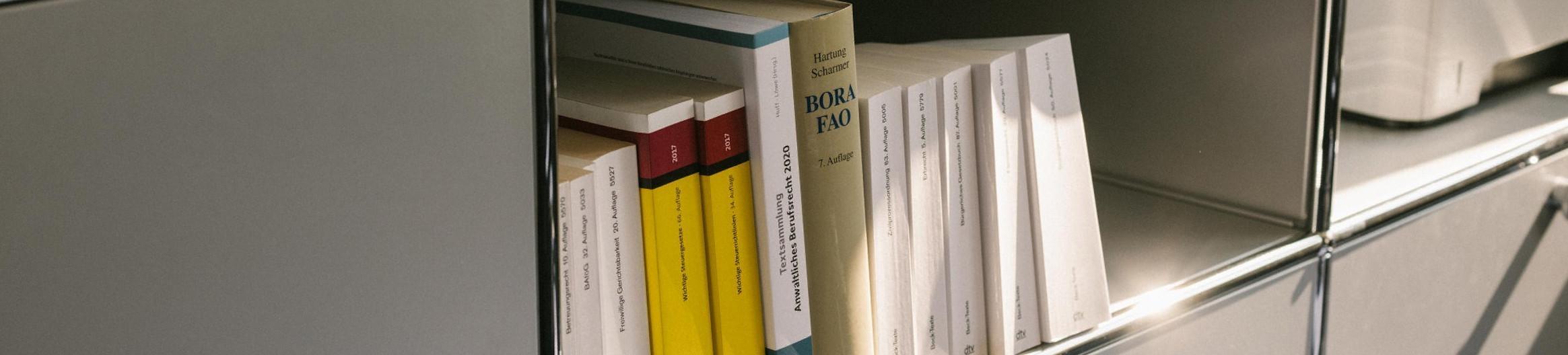
taetigkeitsgebiete-2.jpg
janssen-2.jpg
thomas-staudacher-headset.jpg
neutral.jpg

janssen-staudacher.jpg
neutral-5.jpg
neutral-4.jpg
Das BSG hat mit Urteil vom 12.03.2019 - B 13 R 27/17 R - die Revision der DRV Bund gegen das von Janssen & Staudacher erstrittene Urteil zu Gunsten der Klägerin zurückgewiesen.
Die Gesellschaft in den Industrienationen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Viele Menschen leben allein oder außerhalb von familiären Bezügen und die Lebenserwartung ist deutlich gestiegen. Rein statistisch lebt ein heute 20-jähriger etwa 7,5 Jahre länger als seine heute 50-jährigen Eltern, 12,5 Jahre länger als seine heute 70-jährigen Großeltern und 17,5 Jahre länger als seine heute 90-jährigen Urgroßeltern. Die Kehrseite dieser Entwicklung ist die Zunahme von Erkrankungen im höheren Lebensalter. So steigt die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen kontinuierlich. Umso wichtiger werden Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Denn darin können wir unseren Willen mitteilen, auch wenn wir ihn selber nicht mehr äußern können.
Hinzu kommt, dass durch den medizinischen Fortschritt insbesondere in den letzten Lebensjahren mehr Behandlungen durchgeführt werden. Früher tödlich verlaufende Krankheiten sind heute oft als chronische Erkrankungen behandelbar. Doch medizinische Behandlungen werden nicht selten davon bestimmt, was medizinisch möglich ist. Leider rückt dabei immer wieder die Frage in den Hintergrund, ob eine Behandlung für die Betroffenen sinnvoll ist oder wirklich in deren Interesse.
Sind die Betroffenen nicht mehr in der Lage ihren Willen zu äußern, entscheiden Ärzte über deren Behandlung. Sie versuchen dabei die vermuteten Wünsche ihrer Patienten zu berücksichtigen und fragen die Angehörigen danach. Besonders wichtig ist die Entscheidungsfindung bei lebensverlängernden Maßnahmen wie künstliche Ernährung oder eine künstliche Beatmung. In manchen Fällen kennen die Angehörigen die Wünsche der Betroffenen und können diese vertreten. Doch meist bleibt ihnen nur die Möglichkeit, anhand ihrer eigenen Wertvorstellungen zu entscheiden.
Deshalb ist eine Patientenverfügung für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen und die behandelnden Ärzte eine große Entlastung. Denn eine Patientenverfügung stellt sicher, dass Ärzte und Angehörige bei ihren Entscheidungen die Wünsche der Betroffenen berücksichtigen. Auch wenn diese ihren Willen und ihre Wünsche nicht mehr artikulieren können.
Erfahren Sie mehr über Ihre persönliche Patientenverfügung und eine rechtlich korrekte Vorsorgevollmacht.
Liegt kein Ehevertrag oder Lebenspartnerschaftsvertrag vor, so leben die Ehegatten oder Lebenspartner meist im sogenannten Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Denn dieser tritt mit der Eheschließung automatisch in Kraft. Die Zugewinngemeinschaft endet mit der Scheidung. In diesem Fall kann ein Ehegatte gegen den anderen einen Anspruch auf Ausgleich des Zugewinns haben. Um diesen zu ermitteln, wird das Vermögen von beiden Ehegatten oder Lebenspartnern bei der Heirat mit dem Vermögen zum Zeitpunkt der Scheidung verglichen. Dabei werden aber nicht alle während der Ehe erworbenen Güter zu gleichen Teilen auf beide Partner verteilt. Denn es gibt nur einen Zahlungsanspruch auf die Wertdifferenz.
Ob bei Ihren Vermögensverhältnissen die gesetzliche Regelung günstig ist, erläutern wir Ihnen gern in einem Beratungsgespräch. Dabei beraten wir Sie umfassend: ob die gesetzliche Regelung durch einen Ehevertrag oder Lebenspartnerschaftsvertrag modifiziert werden sollte oder ob andere Regelungen wie eine Gütertrennung in Ihrem Fall geeigneter sind.
Wir erläutern Ihnen, was der Zugewinnausgleich für Sie bedeutet und welche Ausgleichsforderungen im Falle einer Trennung oder Scheidung auf Sie zukommen. Dabei sind die individuellen Rechte an Immobilien oder Unternehmen besonders zu berücksichtigen.
Im Laufe eines Scheidungsverfahrens wird vom Familiengericht der Versorgungsausgleich durchgeführt. Dabei werden die während der Ehe oder der Lebenspartnerschaft erworbenen Ansprüche der Altersvorsorge ausgeglichen. Deshalb werden im Laufe des Verfahrens alle Rentenanwartschaften ermittelt: Betriebsrente, Riesterrente, gesetzliche Rente, Beamtenversorgung, Versorgungswerke, private Rentenversicherungsverträge und Ähnliches.
Damit das Familiengericht die Scheidung schneller durchführen kann, sollten die Ehegatten ihr Rentenversicherungskonto bei der Rentenversicherung geklärt haben. Dazu können sie sich bei den Auskunfts- und Beratungsstellen der gesetzlichen Rentenversicherung beraten lassen und einen Antrag auf Kontenklärung stellen..
Vor der Scheidung können Ehegatten oder Lebenspartner diesen Versorgungsausgleich ausschließen oder modifizieren. Wir beraten Sie zum Versorgungsausgleich und welche Möglichkeiten der vertraglichen Gestaltung es gibt.
Im Scheidungsverfahren ist die Klärung des Versorgungsausgleichs einer der wesentlichen Faktoren, die auch die Dauer von einverständliche Ehescheidungen beeinflussen. Sinnvoll ist es daher, bereit mit dem Scheidungsantrag den ausgefüllten Fragebogen zum Versorgungsausgleich für Ehegatten einzureichen, damit das Familiengericht sofort die beteiligten Versorgungsträger anschreiben kann.
Sie leben von Ihrem Ehepartner oder Lebenspartner getrennt? Sie sind geschieden? Wird Ihr ehemaliger Partner pflegebedürftig, so geht der Unterhaltsanspruch Ihres ehemaligen Partners auf das JobCenter über oder wird vom Sozialamt übergeleitet. Das JobCenter oder Sozialamt wird dann von Ihnen zunächst Auskunft über Ihr Einkommen und Vermögen fordern. Häufig fordert das JobCenter oder Sozialamt auch von Ihnen die Auskunft über das Einkommen und Vermögen Ihres neuen Partners. Diese Auskunft muss das JobCenter bzw. Sozialamt aber direkt bei diesen Personen selbst anfordern. Ist Ihr Einkommen ausreichend, um Unterhalt zu zahlen, wird das JobCenter bzw. Sozialamt Sie zur Zahlung von Unterhalt auffordern.
Wir beraten Sie, ob das JobCenter oder Sozialamt von Ihnen Unterhalt fordern kann. Außerdem klären wir für Sie, wie viel Sie bezahlen müssen und was Sie gegen die Unterhaltszahlung einwenden können. Kommt es zu einer Auseinandersetzung mit dem JobCenter oder Sozialamt, so vertreten wir Sie außergerichtlich und vor dem Sozial- oder Familiengericht.
Kinder haben eine Unterhaltspflicht gegenüber ihren Eltern. Diese ist allerdings deutlich schwächer ausgeprägt als die Unterhaltspflicht der Eltern ihren minderjährigen Kindern gegenüber. Die gestiegene Lebenserwartung und der medizinische Fortschritt haben zur Folge, dass viele Menschen vor dem Tod Unterstützung brauchen oder zum Pflegefall werden. In diesem Fall sind die erwachsenen Kinder gegenüber ihren Eltern unterhaltspflichtig.
Sie finden in der Rubrik Familienrecht mehr zum Elternunterhalt und zur Unterhaltspflicht gegenüber den Eltern.
Sie haben ein behindertes Kind, das Leistungen von der Sozialhilfe bezieht? Trotzdem möchten Sie, dass Ihr Kind von seinem Erbanteil profitiert? Ein sogenanntes Behindertentestament sorgt dafür, dass Ihr Kind sich Dinge leisten kann, die von der Sozialhilfe oder den Leistungen der Krankenversicherung nicht übernommen werden. Ein Behindertentestament stellt Ihrem behinderten Kind zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Von diesen kann es sich besondere Förderung leisten, zusätzliche Betreuung, Therapie und Behandlungen. Die Regelungen des Behindertentestaments sorgen dafür, das Ihr Geld nicht auf die Leistungen der Sozialhilfe angerechnet wird.
Bei einem Behindertentestament gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Diese haben in der Regel gemeinsam, dass dem behinderten Kind ein Erbanteil zugedacht wird, der über dem gesetzlichen Pflichtteil liegt. Durch die Anordnung einer Testamentsvollstreckung sowie einer Vor- und Nacherbenfolge kann das behinderte Kind zu seinen Lebzeiten bestimmte finanzielle Mittel erhalten.
Das bedeutet konkret: Sie ernennen einen Testamentsvollstrecker. Dieser kann Ihrem behinderten Kind Vergünstigungen zukommen lassen, die es vom Sozialhilfeträger nicht erhält. Stirbt Ihr behindertes Kind, so fällt das noch verbliebene Erbe nicht dem Sozialhilfeträger zu, sondern geht auf die Nacherben über.
Durch ein Behindertentestament erhält die übrige Familie, insbesondere die Geschwisterkinder, nach dem Tod des behinderten Kindes das verbliebene Vermögen. Ohne ein solches Testament würde das verbliebene Vermögen auf die Sozialhilfe angerechnet werden. Das Behindertentestament ist durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als zulässig anerkannt.
Wir beraten Sie zu den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten des Behindertentestaments. Entsprechend Ihren Wünschen entwerfen wir ein Testament, das Ihrem behinderten Kind die bestmögliche Pflege und Betreuung gewährleistet und zugleich das verbliebene Vermögen der übrigen Familie erhält.
Wir beraten Sie zur sachgerechten Gestaltung der Testamentsvollstreckung und der Verwaltungsanorndung, mit der Sie als Erblasser genau vorgeben, was der Testamentsvollstrecker für Ihr Kind an Leistungen erbringen kann und soll.
Wenn Sie als Testamentsvollstrecker für ein Behindertentestament eingesetzt sind, beraten wir Sie dazu, welche Zuwendungen an den behinderten Menschen Sie machen dürfen ohne eine Anrechnung auf Sozialleistungen zu verursachen. Dazu erklären wir Ihnen, welche Zuwendung beim Bezug der verschiedenen Arten von Sozialleistungen angerechnet werden und wo nicht.
Informationen zum Bedürftigentestamt zugunsten von Beziehenden von Bürgergeld (bisher ALG II) finden Sie auf unserer Internetseite unter dem Unterpunkt Erbrecht: das Bedürftigentestament.